|
| |
Die Kuren
Schon im 4. Jh. v. Chr. wurde das Memelland
besiedelt. Es handelte sich um Kulturen, die, durch archäologische Funde belegt,
aus der Dnjpr-Region in Weißrussland stammen. Zu der sogenannten
Memelland-Kultur zählen auch die zu den indo-europäischen Baltenstämmen
zählenden Kuren, die sich etwa ab 2500 v. Chr. entlang der Ostseeküste
ansiedelten.
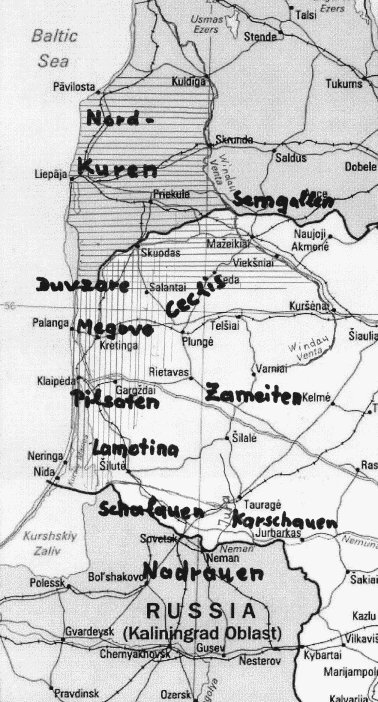 Etwa vom 2. bis 5. Jh. nach Chr. spricht man vom
„Goldenen Zeitalter der Balten“, denn während dieser Periode wird eine
langwährende ungestörte Besiedlung durch etwa 1000 Gräberfelder nachgewiesen,
weil die Bestattungsriten während dieser Zeit unverändert geblieben sind. Die
Gräber der Kuren unterscheiden sich von anderen dadurch, dass die Toten inmitten
runder oder rechteckiger Steineinfriedungsringe bestattet wurden. Auch gab es
keinerlei Anzeichen von Abwanderungen, Bevölkerungsverschiebungen oder von
Invasionen fremder Stämme. Etwa vom 2. bis 5. Jh. nach Chr. spricht man vom
„Goldenen Zeitalter der Balten“, denn während dieser Periode wird eine
langwährende ungestörte Besiedlung durch etwa 1000 Gräberfelder nachgewiesen,
weil die Bestattungsriten während dieser Zeit unverändert geblieben sind. Die
Gräber der Kuren unterscheiden sich von anderen dadurch, dass die Toten inmitten
runder oder rechteckiger Steineinfriedungsringe bestattet wurden. Auch gab es
keinerlei Anzeichen von Abwanderungen, Bevölkerungsverschiebungen oder von
Invasionen fremder Stämme.
In der mittleren Eisenzeit, der Zeit zwischen dem
5. und. 9. Jh., veränderten sich die Lebensbedingungen der baltischen Stämme,
denn von Osten und Süden her wurden sie durch die Expansion der Slawen unter
Druck gesetzt, und von der Ostsee drängten Schweden und Wikinger ins Land. Die
prußischen und kurischen Stämme spielten während dieser Periode die führende
verteidigende Rolle unter den Baltenstämmen.
Kurische und prußische Siedlungen sind an der Art
ihrer Bestattungen unterscheidbar: Die Prußen äscherten ihre Toten ein, während
die Kuren ihre für sie typischen Körpergräber bis ins 7. Jh. beibehielten. Sie
gebrauchten immer noch Steinwälle, inmitten denen die Gräber wabenförmig
nebeneinander liegen. Erst ab dem späten 7. Jh. und dem 8. Jh. wurde die
Einäscherung übernommen. Dass die Kuren sich gegen skandinavische Einfälle
wehren mussten, belegen Grabbeigaben.
Ab dem 5. Jh. sind Burgberge belegt. Diese
Hügelburgen wurden bevorzugt auf Steilufern oder in Gewässern auf Landzungen
errichtet und mit Wällen aus Baumstämmen und gestampftem Lehm befestigt. Der
Innenraum einer solchen Burg betrug zwischen einem halben und einem ganzen
Hektar.
Die erste urkundliche Erwähnung der Kuren stammt
aus dem 9.Jh., als ein gewisser Rimbert schreibt: „Ein Volk, das Chori genannt
wird und fern von ihnen lebt, war einst von den Schweden unterworfen worden.
Aber es ist schon so lange her, daß sie sich erhoben und das Joch
abschüttelten.“
Der Kontakt mit ihren Feinden scheint sich auch
auf das Verhalten der Kuren abgefärbt zu haben, denn zwischen dem 11. und. 13.
Jh. hatten sie sich zu den „Wikingern unter den Balten“ entwickelt. Obwohl sehr
reich, machten sie sich wagemutig auf Beutezüge. So musste Dänemark seine Küsten
sommers wie winters schützen. In einem überlieferten Gebet heißt es: „O
mächtiger Gott, bewahre uns vor den Kuren.“ Chroniken des 13. Jh. berichten,
dass Kuren mehrmals Dänemark und Schweden verheerten, plünderten, Kirchenglocken
und anderes Gerät mitschleppten. Adam von Bremen riet allen Christen, die
kurländische Küste zu meiden. Kurische Geräte, wie sie typisch für die Gegend
von Memel und Kretinga sind, wurden auch in Skandinavien gefunden.
Bereits im 10. und 11. Jh. zog das reiche
Kurland, das einen außerordentlichen kulturellen Aufschwung genommen hatte,
beutegierige Wikinger, Schweden, Dänen und sogar Isländer an. Diese wurden aber
recht häufig von den Kuren in eine Falle gelockt und im Gegenzug an deren Küsten
ausgeplündert. Sogar die isländische Egilsaga beschreibt Einzelheiten aus dem
Leben eines kurischen Feudalherren.
Im 12. Jh. vollzog sich jedoch eine allmähliche
Wandlung, denn als die Ordensritter eindrangen, waren die südkurischen
Landschaften nahezu menschenleer. Der Großteil der kurischen Bevölkerung war
nach Norden abgewandert. Die Ursache lag in lange Jahre anhaltenden
Niederschlägen, die zu einer Klimaveränderung geführt hatten, welche die
Menschen langfristig veranlassten, ihre feuchten Wohnplätze in den Niederungen
entlang der Ostsee aufzugeben und in den an sich klimatisch ungünstigeren Norden
auszuweichen. Zahlreiche Ordensurkunden befassen sich mit kurischen Landschaften
und geben Auskunft, dass Nordkurland besiedelt war, also auch aufgeteilt werden
konnte, während die südkurländischen Landschaften als „den landen, die noch
ungebuwet sin“ bezeichnet wurden. Dass der Süden Kurlands nicht gänzlich
unbesiedelt war, wird auch in Ordensurkunden belegt, denn man bediente sich
häufig der kundigen eingesessenen „seniores“, wenn es darum ging, Landstriche zu
kennzeichnen und zu benennen.
Unter den südkurischen Landschaften versteht man
Duvzare, den Küstenstrich nördlich von Palanga, die Küstenbereiche des
Memellandes Megowe, Pilsaten und Lamotina, sowie die Landschaft Ceclis, die weit
in das heutige Szemaiten hineinreicht. Die prußischen Schalauer bewohnten die
Gegend südlich und nördlich der Memel, während die vermutlich szemaitischen
Karschauer den östlichen Zipfel des Memellandes besiedelten.
Allen diesen südkurischen, szemaitischen und
nadrauischen Gebieten ist gemeinsam, dass sie ab dem 12. Jh. von der Bevölkerung
weitgehend aufgegeben wurden. Es hielt sich eine geringe Anzahl die Wildnis
durchstreifende Menschen, die diese wirtschaftlich nutzten (Jagd, Fischerei,
Bienenwirtschaft). Wenn auch durch den Abzug der Kundschaft die Absatzmärkte
nahezu weggebrochen waren, so stellte die Große Wildnis für ihre Nutzer doch
einen erheblichen Wert dar. Durch diese halbnomadisch lebenden Jäger blieben die
vertrauten, sich an natürlichen Gegebenheiten orientierenden Landschaftsnamen
erhalten und fanden sich später in Ortsnamen sowohl auf ostpreußischer als auch
szemaitischer Seite wieder (Beispiel Krottingen). In vorwiegend litauischer
Literatur wird versucht nachzuweisen, dass der Orden die Kuren vertrieben oder
gar ausgerottet habe. Dem steht gegenüber, dass die Entvölkerung bereits vor dem
Auftreten des Ordens stattgefunden hatte und dass dieses Argument schon deshalb
unlogisch ist, weil der Orden die nördlichen (im heute lettischen Bereich
wohnenden) Kuren am Leben gelassen hat.
 Es ist davon auszugehen, dass die nordkurische
Bevölkerung nie die Besuche im südlichen Kuren-Gebiet aufgegeben hat, denn als
hervorragende Seeleute kannten sie ihre alten Gründe. Schließlich auch bedeutet
der Name Kure „schnell zu Wasser“. Bewohner der Kurischen Nehrung berichteten
noch im 20. Jh., dass lettische Kuren bei Schlecht-Wetter Schutz im Haff suchten
und bei Nehrungsbewohnern übernachteten. Probleme bei der sprachlichen
Verständigung habe es dabei kaum gegeben. Überliefert ist auch, dass die
kurische Sprache zuletzt eine reine Männersprache war, die nur auf den Schiffen
gebraucht wurde. Da kurische Männer gerne Frauen aus den anderen baltischen
Brudervölkern heirateten, war es üblich, zu Hause die Muttersprache und auf See
die Männersprache zu sprechen, die ja letztlich auch eine Fachsprache war. Dass
sie zudem auch recht rüde war, belegen etliche kurische Familiennamen. Es ist davon auszugehen, dass die nordkurische
Bevölkerung nie die Besuche im südlichen Kuren-Gebiet aufgegeben hat, denn als
hervorragende Seeleute kannten sie ihre alten Gründe. Schließlich auch bedeutet
der Name Kure „schnell zu Wasser“. Bewohner der Kurischen Nehrung berichteten
noch im 20. Jh., dass lettische Kuren bei Schlecht-Wetter Schutz im Haff suchten
und bei Nehrungsbewohnern übernachteten. Probleme bei der sprachlichen
Verständigung habe es dabei kaum gegeben. Überliefert ist auch, dass die
kurische Sprache zuletzt eine reine Männersprache war, die nur auf den Schiffen
gebraucht wurde. Da kurische Männer gerne Frauen aus den anderen baltischen
Brudervölkern heirateten, war es üblich, zu Hause die Muttersprache und auf See
die Männersprache zu sprechen, die ja letztlich auch eine Fachsprache war. Dass
sie zudem auch recht rüde war, belegen etliche kurische Familiennamen.
|
Am Meer, am Strande,
an der Ostsee im Sande,
da steht eine Hütte gar lieblich, gar klein.
Da wohnte mein Vater,
was möglich war, tat er,
denn ich war sein einziges Goldvögelein.
Auf Wellen, auf Wogen,
ward´ ich auferzogen,
der schaukelnde Kahn
sollt´ die Wiege mir sein.
(altes Lied)
|
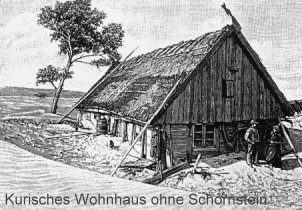 |
Ab dem 14. Jh. setzte eine Rückwanderung der
kurischen Bevölkerung in die alten Gebiete ein, denn inzwischen hatte sich das
Klima gebessert, und die Wildnis konnte wieder besiedelt werden. Die Kuren kamen
recht früh, denn als zunehmend Szemaiten und Litauer als Siedler akzeptiert
wurden, befanden sich die Kuren zusammen mit den Prußen bereits in
priviligierteren rechtlichen Stellungen. Diese „neuen“ Kuren hatten jedoch ihre
alte Sprache weitgehend vergessen und sprachen einen lettischen Dialekt. Zudem
lebten ab dem 15. Jh. in den alten südkurischen Landschaften nun auch Deutsche,
Prußen, Szemaiten und Litauer, so dass sich unter der ländlichen Bevölkerung
eine Sprache herausbildete, die lettisch, prußisch und vor allem litauisch
geprägt war, sich jedoch in vielen Begriffen vom Litauischen unterschied. Ein
wichtiges Bindeglied zur deutschen Kultur war die plattdeutsche Sprache. Dass
viele deutsche Wörter übernommen wurden, zeigt das nehrungs-kurische Wörterbuch
von Richard Pietsch. Die Landbevölkerung war durchweg mehrsprachig, jedoch
beherrschte sie selten die hochdeutsche Sprache, die Sprache des Rechts, der
Schulen und der Gottesdienste. So stellte sich die Kirche darauf ein, indem sie
je nach Ortschaft deutsch oder litauisch predigen ließ, denn Litauisch war die
Sprache, die letztlich alle verstanden und die die Prediger deshalb erlernen
konnten, weil sich eine litauische Schriftsprache herausgebildet hatte, während
die Sprachen der Kuren und Prußen langsam ausstarben.
Die Kuren galten unter ihren ostpreußischen
Mitmenschen schon als eigenartiges Völkchen, das man beäugte und über das man so
seine Geschichten erzählte. Ihre Häuser galten als primitiv, hatten sie doch
keinen Schornstein, und das Innere der Häuser war dem entsprechend verqualmt.
Für ihre Bewohner machte das aber durchaus einen Sinn, wurden doch so im
Bodenraum die Netze getrocknet und auch die Fische geräuchert.
„Groß war ihr Aberglaube“, schreiben mehrere
Chronisten, und tatsächlich hatte sich der alte heidnische Glaube bis in das 20.
Jh. erhalten und wurde zumindest bei Familienfeiern und im Brauchtum noch
praktiziert. Es gab unzählige Seher, Wahrsager, Besprecher, Heilmittelhersteller
und Quacksalber. Und man glaubte an die Bedeutung von Träumen. So erzählte mir
der hochverehrte Richard Pietsch, der in Funk und Fernsehen als der „letzte
Kure“ bezeichnet wird, dass er das New Yorker Unglück des 9. September 2001
vorausgeträumt habe und sehr unter seinen seherischen Fähigkeiten litte. Ich
glaube ihm, denn er ist nicht der erste Memelländer, der mir von so etwas fast
verschämt berichtete, weil es in unsere heutige rationale Welt nicht so recht
hineinpassen will und als esotherisch und spinnerhaft gilt.
Es gab zahlreiche ostpreußische Redensarten, die
sich auf die Kuren beziehen. So bezeichneten sich Betrunkene gerne als „von
Kuren verhext“, stürmisches Wetter wurde „kurisches Wetter“ genannt, und „Kurischer
Kaffee“ war Warmbier mit Schnaps. Mit kurischen Marktfrauen legte sich keine
Königsbergerin gerne an, fürchtete sie doch, von ihr verflucht zu werden. Etwas
abergläubisch waren die immerhin aufgeklärt tuenden Stadtmenschen doch, um nicht
den Geschichten zu glauben, dass die Kuren, wenn sie ihre Marktstände mal kurz
verlassen wollten, diese mit einem einzigen Hexenblick derart zu sichern in der
Lage waren, dass ein etwaiger Dieb solange angewurzelt stehenbleiben musste, bis
der Besitzer zurückkehrte.
Ein Kure sah die Situation allerdings anders: „On
wenn man nu heert, de Keenigsberjer Feschwiewer wäre frech on driest, dat wäre
nech onse Fescherfruues, dat wäre vielleicht denn de städtsche Kuppelwiewer, de
Handelswiewer ute Stadt. Onse Fruues hadde seck fär em Markt scheen
trechtjemoakt, se tooge denn frisch jestärkte Röck an on groote schwarte
Koppdeeker. On under ehre groote Marktscherz, doa hadde se dat Portmonnee, de
Wechseltasch. Joa, on denn wurd da verkofft. Also, eck mott joa segge, de meiste
hadde joa Stammkunde, de se all veele, veele Joahre kennte. On eck mott joa
segge, de beste Kunde en Keenigsbarch fär de Fescher, dat wäre joa de Jude. De
häbbe veel, veel Fesch jejäte.
On wenn denn oawends de Fruues denn wedder tohuus
wäre, denn wurd dat Jeld jetellt, on wenn neetich, met dem Partner ook forts
jedeelt. On dat wär alles meistens Sach von de Fruues. Joa, de Männer, manchmoal
am Sinnoawend wäre se joa ook manchmoal doabi, oaber to segge hadde se doa
nuscht!“
 Die kurischen Männer werden beschrieben, dass sie
fast durchweg bartlos waren und kurzgeschnittene Kopfhaare trugen. In der Regel
waren sie mit Jacken oder Jacketts bekleidet, die von weißer oder blauer Wolle
gestrickt oder selbstgewirktem Wollstoff hergestellt waren. Dazu trugen sie
Drillichhosen und je nach Wetterlage eine Mütze oder einen Südwester. Ging es
zum Fischfang, zog man dicke friesähnliche Wandröcke und lange, bis über die
Knie reichende Wasserstiefel an. Im Winter trug man Klotzschlorren, im Sommer
gingen alle meistenteils barfuß. Die kurischen Männer werden beschrieben, dass sie
fast durchweg bartlos waren und kurzgeschnittene Kopfhaare trugen. In der Regel
waren sie mit Jacken oder Jacketts bekleidet, die von weißer oder blauer Wolle
gestrickt oder selbstgewirktem Wollstoff hergestellt waren. Dazu trugen sie
Drillichhosen und je nach Wetterlage eine Mütze oder einen Südwester. Ging es
zum Fischfang, zog man dicke friesähnliche Wandröcke und lange, bis über die
Knie reichende Wasserstiefel an. Im Winter trug man Klotzschlorren, im Sommer
gingen alle meistenteils barfuß.
Die Frauen trugen langärmlige Blusen unter einem
Mieder und dazu gesteifte Röcke, deren Zahl mit dem Wohlstand einer Frau zunahm.
Frauen trugen immer ein Kopftuch, Mädchen dagegen nur auf Ausgängen. An
Festtagen drapierten sie das Kopftuch um ein Häubchen.
|
Zu den Fischern gehn wir,
besuchen Fischer,
bei Fischern wollen wir frein.
Wie weich die Händchen
der Fischermädchen,
wie kühl sind ihre Bettchen.
Zu Häupten ein Ruder,
ein Netz zur Seite,
ein Segel zum Bedecken.
(altes litauisches Lied)
|
 |
Was den Charakter der Kuren betrifft, so wird
berichtet, dass sie zäh am Althergebrachten hingen und für Neuerungen, sollten
sie noch so zeitgemäß und vorteilhaft für sie sein, fast gänzlich unzugänglich
waren. Ein „melancholischer Hauch über ihrem Wesen“ wird mit ihrem
immerwährenden Kampf gegen die Elemente, mit ihrer Abgeschlossenheit vom übrigen
Leben und mit ihrem Trotz und ihrer scheuen Zurückgezogenheit begründet. Sie
werden beschrieben, dass sie in allen Lebensverhältnissen von „strenger
Rechtlichkeit“ und „höchst gastfrei“ sind. Andererseits werden sie als
unbarmherzig gegen gestrandete Schiffsbrüchige bezeichnet, allerdings das nur
hinsichtlich der Schiffsladung. Was an den Strand geworfen wurde, sahen sie als
ihr Eigentum an. Die Kuren galten als schwer zugänglich, und es dauerte eine
Zeit, bis sie Fremden gegenüber aufgeschlossener wurden. Aber ihre
unverwechselbare Physiognomie, der freundliche, offene Blick aus ihren blauen
Augen und ihr diskreter Charme machte auf Chronisten einen ebenso sympathischen
Eindruck wie ihre offensichtliche Lebenstüchtigkeit.
Es ist nicht so, dass die Kuren nur auf der
Nehrung lebten, die für Feldwirtschaft nicht geeignet war. Der Großteil der „Zippel-Kuren“
genannten Bevölkerung lebte um das Haff herum und im Memel-Delta und betrieb
Gemüseanbau. Mit ihren Timberkähnen brachten sie Zwiebeln, Kürbisse, Kohl,
Bohnenkraut und Porree zum Königsberger Stadthafen, nach Labiau und Tilsit, um
ihre Erzeugnisse dort direkt zu vermarkten. Großabnehmer für das Heu, das
hochaufgetürmt auf den Kähnen transportiert wurde, war die Heeresverwaltung.
Auch die Fischmärkte wurden selbstverständlich über die Wasserwege beschickt.
 „On oppem Feschmarkt, denn jinge joa emmer bloß
de Frues. Dat wurd ook von de Männer anerkannt, dat Jeld vom Verkoop opp em
Markt, dat wär alles bi de Fescherfruu. On de meiste Frues, de moakte dat ook
sehr goot. Eck häbb doa von de Männer nie Kloage jeheert. Joa, on de Frues, de
fuhre denn meedweeks on vor alle Dinge sinnoawends met em Damper oppem
Feschmarkt en Keenigsbarch. On dem Fesch hadde se en Kuppelkärw on Oalkärw all
sorteert. Disse Kärw wäre sehr stabil, met em Krommholt oder Peed kunnst twee
doavon goot droage. Doa jinge emmer so etwa e halwer Zentner ren. On de Oalkorb,
de mott scheen dicht jeflochte sen, de Kuppelkärw, de kenne all loftjer senne.
On denn wußte nu all emmer Bescheed. Wieveel Kärw nemmt se hiede met? „On oppem Feschmarkt, denn jinge joa emmer bloß
de Frues. Dat wurd ook von de Männer anerkannt, dat Jeld vom Verkoop opp em
Markt, dat wär alles bi de Fescherfruu. On de meiste Frues, de moakte dat ook
sehr goot. Eck häbb doa von de Männer nie Kloage jeheert. Joa, on de Frues, de
fuhre denn meedweeks on vor alle Dinge sinnoawends met em Damper oppem
Feschmarkt en Keenigsbarch. On dem Fesch hadde se en Kuppelkärw on Oalkärw all
sorteert. Disse Kärw wäre sehr stabil, met em Krommholt oder Peed kunnst twee
doavon goot droage. Doa jinge emmer so etwa e halwer Zentner ren. On de Oalkorb,
de mott scheen dicht jeflochte sen, de Kuppelkärw, de kenne all loftjer senne.
On denn wußte nu all emmer Bescheed. Wieveel Kärw nemmt se hiede met?
On de dieerste on wertvollste Fesch, dat wär jos
denn nu de Oal. De wurd en dree Sorte sorteert: groote, meddlere on kliene. On
de andre Fesch, dat wär denn je noa Joahrestied Zander, Schlie, Quappe, Neenooge,
Brasse on denn noch so Biefang – dat wurd denn joa ook alles so sorteert. On all
opp em Damper hadde de Fruues ehre feste Plätze – de satte därperwies – on denn
joa ook oppem Feschmarkt em Marktkeller. Doa wär so e Verkoopsdesch, so veer
Meter hadde wi. On oak doa stunde de Feschfruues emmer so noa Därper jetrennt:
doa wäre de Temmerbooder, de Peyser, de Heydekröger, de Nautzwinkler on so.“
Fischmarkt in Königsberg
 Die Kurischen Fischer bauten ihre Boote selbst.
Die Bootstypen wurden nach der charakteristischen Art ihrer Netze benannt: Der
Keitel (kidel) ist ein 10 bis 12 Meter langes trichterförmiges Netz, das von nur
einem Boot, dem Keitelkahn gezogen wird. Keitelkähne konnten noch bei Windstärke
9 rentabel fischen, Kurrenkähne noch bei Windstärke 8, und selbst bei Orkan war
eine Rückkehr noch möglich. Das Kurrennetz war ein dreiwandiges Netz von 240 bis
300 Meter Länge und musste von zwei gleichstarken Segelkähnen mit der
Windrichtung geschleppt werden. Da diese Schiffe einer sehr starken Belastung
ausgesetzt waren, musste die Stärke des Bauholzes ebenso dick sein wie die eines
Keitelkahnes. Die Braddenkähne brauchten nicht so starkes Bauholz, fischten aber
auch zu zweit mit einem 180 Meter langen Netz. Alle Haffboote hatten einen
Tiefgang von nur 40 Zentimetern. Für die Nachtfischerei waren mehrere Netze in
Gebrauch, auch gab es eine große Anzahl spezieller Netze, je nachdem auf welchen
Fisch man aus war. Im nördlichen Kurischen Haff war die Reusenfischerei sehr
hoch entwickelt. Die Kurischen Fischer bauten ihre Boote selbst.
Die Bootstypen wurden nach der charakteristischen Art ihrer Netze benannt: Der
Keitel (kidel) ist ein 10 bis 12 Meter langes trichterförmiges Netz, das von nur
einem Boot, dem Keitelkahn gezogen wird. Keitelkähne konnten noch bei Windstärke
9 rentabel fischen, Kurrenkähne noch bei Windstärke 8, und selbst bei Orkan war
eine Rückkehr noch möglich. Das Kurrennetz war ein dreiwandiges Netz von 240 bis
300 Meter Länge und musste von zwei gleichstarken Segelkähnen mit der
Windrichtung geschleppt werden. Da diese Schiffe einer sehr starken Belastung
ausgesetzt waren, musste die Stärke des Bauholzes ebenso dick sein wie die eines
Keitelkahnes. Die Braddenkähne brauchten nicht so starkes Bauholz, fischten aber
auch zu zweit mit einem 180 Meter langen Netz. Alle Haffboote hatten einen
Tiefgang von nur 40 Zentimetern. Für die Nachtfischerei waren mehrere Netze in
Gebrauch, auch gab es eine große Anzahl spezieller Netze, je nachdem auf welchen
Fisch man aus war. Im nördlichen Kurischen Haff war die Reusenfischerei sehr
hoch entwickelt.
Das Fischereirecht regelte sehr genau, wann wie
mit welchem Garn zu fischen war. Wohl am faszinierendsten war die körperlich
außerordentlich anstrengende Eisfischerei. Hier hatte jeder Fischwirt nur das
Recht für halbes Wintergarn, so dass er gezwungen war, mit einem Kollegen
zusammen zu arbeiten. Außerdem benötigte man sechs bis zehn Gehilfen, zwei
Kastenschlitten, sogenannte Waschen, mit aufmontierten Winden sowie zahlreiches
Gerät: Eisäxte, Eisstemmen, Eisstecher, diverse Gabeln, Stangenhaken und zwei
zusammensteckbare Stangen von etwa 10 Zentimeter dicke und 50 Meter Länge. Die
Arbeit begann vor Sonnenaufgang, und das Fangglück bestand darin, dass man auf
Fischlager stieß, in denen sich die Fische träge versammelt hatten. Einzelne
Fischer arbeiteten weniger aufwendig mit Stellnetzen, andere bevorzugten die
Klapperfischerei, die vor dem 1. Weltkrieg eine Zeitlang verboten war, weil sich
hier eine Menge nichtberuflicher Fischer betätigten.
Als Zeugnis ostpreußischer Volkskunst werden die
aus Holz geschnitzen, gesägten und bunt bemalten Schiffswimpel an den Masten der
Keitelkähne betrachtet. Litauische Künstler stellen sie heute wieder auf der
Kurischen Nehrung zum Verkauf her. Aber so sehr alt ist diese Kunst noch gar
nicht, denn sie wurde erst 1844 von der Regierung in Königsberg für 136
fischereiberechtigte Ortschaften der beiden preußischen Haffe verordnet: „daß jeder Berechtigte bei Ausübung der
Fischerei... auf der Spitze des Mastes eine wenigstens zwei Fuß lange und einen
Fuß breite Flagge von derjenigen Farbe, welche der Ortschaft, woselbst er seinen
Wohnsitz hat, von der Regierung erteilt worden ist, führen soll.“
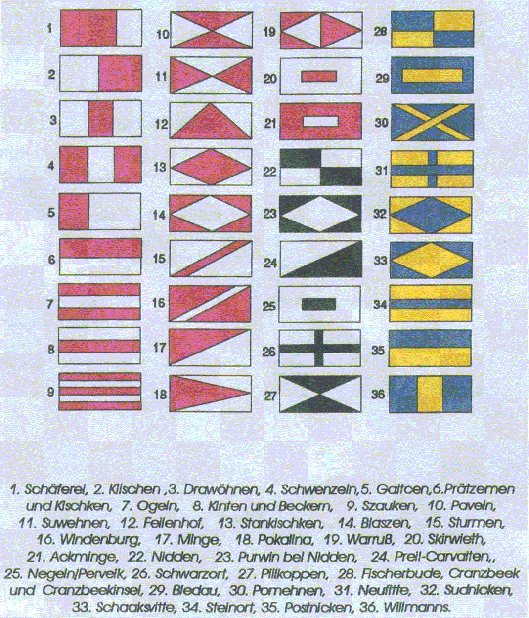 Mit dieser Maßnahme sollte die Kontrolle der
Fischerei erleichtert werden, weil immer wieder Fischer bei der unberechtigten
Ausübung des Fischfangs angetroffen wurden. Wer ohne Ortsflagge fuhr, wurde mit
1 bis 10 Talern Strafe belegt, wer mit falscher Flagge segelte, zahlte zwischen
10 und 50 Talern. Die Orte der Ostküste des Kurischen Haffes fuhren mit
rot-weißer Kennzeichnung, die Südküste hatte blau-gelb. Die Orte auf der
Kurischen Nehrung führten die Farben schwarz-weiß. Die Ortskennzeichen waren
also nur die Grundform, alles andere blieb der Fantasie, der Darstellung des
eigenen Wohlstandes, der Selbstdarstellung oder auch nur der Darstellung eigener
Wünsche und Träume überlassen. Letztlich hing auch alles vom handwerklichen
Geschick eines jeden Fischers ab. Mit dieser Maßnahme sollte die Kontrolle der
Fischerei erleichtert werden, weil immer wieder Fischer bei der unberechtigten
Ausübung des Fischfangs angetroffen wurden. Wer ohne Ortsflagge fuhr, wurde mit
1 bis 10 Talern Strafe belegt, wer mit falscher Flagge segelte, zahlte zwischen
10 und 50 Talern. Die Orte der Ostküste des Kurischen Haffes fuhren mit
rot-weißer Kennzeichnung, die Südküste hatte blau-gelb. Die Orte auf der
Kurischen Nehrung führten die Farben schwarz-weiß. Die Ortskennzeichen waren
also nur die Grundform, alles andere blieb der Fantasie, der Darstellung des
eigenen Wohlstandes, der Selbstdarstellung oder auch nur der Darstellung eigener
Wünsche und Träume überlassen. Letztlich hing auch alles vom handwerklichen
Geschick eines jeden Fischers ab.
Auf der Spitze wurde oft die Wellengöttin
Bangputtis dargestellt. Ebenso beliebt war der Schiffergott Bardoaitis oder
Perdoitos, dessen eine Hand Richtung Himmel und dessen andere Hand Richtung
Wasser zeigte. Daneben wurden alte heidnische geometrische Ornamente wie
Sechsstern und Radkreuz übernommen. Aber unbekümmert daneben wurden auch Häuser,
Kirchen, Schiffe, selbst Fahrräder eingefügt.
Ich werde manchmal gefragt, wo die Kuren denn
geblieben sind. Nun, die Frage ist ganz einfach zu beantworten: Sie haben sich
mit den anderen Einwohnern des nördlichen Samlands, der Elchniederung und des
Memellandes vermischt. Auch wenn sie bei Hermann Sudermann und Ernst Wichert
„Litauer“ genannt werden, sind sie ebenso zu Ostpreußen geworden wie die Prußen
und leben in vielen von uns fort.
|
 |
Literatur:
Ambrassat, August "Die Provinz Ostpreußen", Frankfurt/ Main 1912;
Gaerte, Wilhelm "Urgeschichte Ostpreussens", Königsberg 1929;
Gimbutas, Marija "Die Balten", München-Berlin 1983;
Lepa, Gerhard (Hrsg) "Die Schalauer", Tolkemita-Texte Dieburg 1997;
Mortensen, Hans und Gertrud "Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens
bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts", Leipzig 1938;
Tolksdorf, Ulrich "Fischerei und Fischerkultur in Ostpreußen", Heide/
Holstein 1991;
Woede, Hans "Fischer und Fischerei in Ostpreußen", Leer 1985 |
|